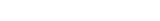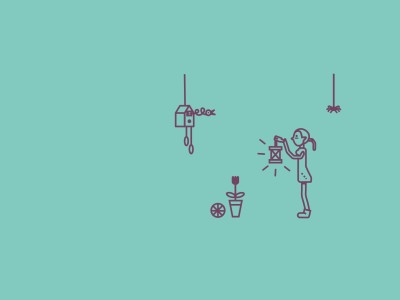Wo reisen wir hin?
Reisen ist für uns selbstverständlich geworden. Ist das ferne Ziel tatsächlich der Zweck des Reisens?, fragt Autor Charles Lewinsky.
Wenn wir die Weltliteratur als Abbild der Wirklichkeit nehmen und uns die klassischen Mobilitätsgeschichten einmal näher ansehen, dann ist der Zweck der darin geschilderten Reisen immer nur scheinbar ein fernes Ziel. Bei genauerer Betrachtung ist es gerade umgekehrt: Die Protagonisten machen sich in unbekannte Gefilde nur auf, um wieder nach Hause kommen zu können. Schon die grossen Dichter der Antike wussten das: Homer liess seinen Odysseus nur deshalb in der ganzen damals bekannten Welt seine Abenteuer erleben, um ihn nach zehn bewegten Jahren bei seiner Frau Penelope im heimischen Ithaka zur Ruhe kommen zu lassen. Und auch Jason und seine Argonauten unternahmen ihre Expedition zum Goldenen Vlies nur, um ihre Trophäe nach zahllosen Heldentaten nach Hause bringen zu können. Wenn wir ein paar Jahrtausende weiterspringen, hat sich nichts verändert: Auch Jonathan Swifts Gulliver oder Daniel Defoes Robinson besuchen die abgelegensten Weltgegenden nur, um am Schluss in der alten Heimat davon zu berichten. Selbst die Kinderliteratur bestätigt dieses Schema: Heidi wird erst glücklich, nachdem sie wieder zum Alpöhi zurückkehren darf, und auch Pippi Langstrumpf kehrt aus dem Taka-Tuka-Land in die wohlvertraute Villa Kunterbunt zurück.
All diesen Geschichten – und es liessen sich Hunderte andere aufzählen – liegt eine Aussage zugrunde: Das letzte Ziel jeder Reise ist die Rückkehr zu ihrem Anfang. Oder anders formuliert:
Um die Abwechslungen und Aufregungen der Mobilität geniessen zu können, brauchen wir die Gewissheit, dass wir sie – wenn wir das wollen – jederzeit beenden können. Solange wir nicht vergessen, wo wir herkommen, und die innere Gewissheit haben, dass uns der Weg zurück nicht für alle Zeit versperrt ist, sind wir frei, die Welt zu erkunden.
Wenn uns diese Sicherheit genommen wird – wobei die Unmöglichkeit, an den Ausgangspunkt unserer Reise zurückzukehren, auch nur eingebildet sein kann –, werden wir vom «morbus helveticus» befallen, wie man das im 18. Jahrhundert nannte. Mit anderen Worten: Wir bekommen Heimweh. Eidgenössische Söldner im Ausland sollen dafür so anfällig gewesen sein, dass sie nicht einmal allzu weit von der Heimat entfernt sein mussten, um nach Anhören des «Ranz des Vaches» fahnenflüchtig zu werden. Schon das Elsass konnte zu weit weg vom vertrauten Herkunftsland sein, so wie es das Volkslied vom heimwehkranken Deserteur beschreibt: «Zu Strassburg auf der Schanz, da ging mein Trauern an.»
Die Tatsache, dass man vom Heimweh wie von einem Virus befallen werden kann, bedeutet aber keineswegs, dass Mobilität, also der Zustand des Unterwegs- oder Anderswoseins deshalb negativ behaftet wäre. Wenn Abenteuerlust und Entdeckerfreude nicht fest in unseren Genen verankert wären, wäre die Menschheit wohl nie aus der afrikanischen Steppe herausgekommen, niemand würde versuchen, seinem Leben in einem anderen Land einen ganz neuen Inhalt zu geben, und die Ferienflieger auf die Malediven wären nicht so überfüllt. Aber wir haben ja auch die Gewissheit, dass es immer ein anderes Flugzeug gibt, das uns im Notfall schnell nach Kloten zurückbringt.
Und noch etwas anderes sorgt dafür, dass die Sehnsucht nach der vertrauten Umgebung nicht mehr als virulente Krankheit, sondern höchstens noch als harmloser seelischer Schnupfen ausbricht: Die verschiedenen Weltgegenden werden sich immer ähnlicher. Natürlich, die Australier werden immer gastfreundlicher sein als die Schweizer, die Israelis unhöflicher und die Italiener chaotischer. Aber rund um den Globus schenkt dasselbe Starbucks denselben Venti Latte mit Sojamilch und Vanille aus, und die immer gleichen Läden wechseln nur ihre Reihenfolge, egal welcher Einkaufsstrasse wir entlangbummeln oder welches Shoppingcenter wir besuchen. Wir haben das Gefühl, ungeheuer mobil zu sein, aber oft haben wir nur dafür gesorgt, dass es anderswo immer mehr so aussieht wie bei uns.
Wenn Circe dieselben Lieder gesungen hätte, die auch in Ithaka in der Hitparade auftauchten – Odysseus hätte sich nicht die Ohren verstopfen müssen, sondern hätte stattdessen vor Anker gehen und mitschunkeln können. Gulliver wäre bei den Liliputanern geblieben, wenn es dort im Supermarkt sein vertrautes Frühstücksmüesli gegeben hätte, nur die Winzigkeit der Packungen hätte ihn vielleicht gestört. Und Pippi Langstrumpf wäre immer noch im Taka-Tuka-Land, wenn im dortigen Fernsehen dieselben Kinderserien liefen, die sie sich schon in der Villa Kunterbunt immer so gern angesehen hatte.
Je selbstverständlicher es für uns wird, weltweit mobil zu sein, desto schwieriger wird es, Mobilität auch tatsächlich zu erleben. Denn wenn der Begriff einen Sinn haben soll, darf er ja nicht nur einfach eine räumliche Veränderung bezeichnen, sondern muss die Bereitschaft einschliessen, sich auf eine anders geartete Umwelt einzulassen. Wenn sie überall gleich ist, haben wir auch keinen Grund mehr, irgendwann nach Hause zu kommen. Ein Zuhause, das es überall gibt, ist irgendwann keines mehr.