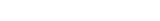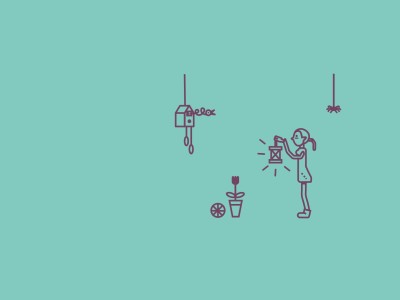Die Emotionalität des Eigentums
Vor einiger Zeit machte ein Sachbuch Furore in Literaturkreisen. Es trägt den etwas effekthascherischen Titel «Der Bestseller-Code» und beruht auf der Durchleuchtung von ganzen Datenbanken an Büchern mittels Big-Data-Analyse auf wiederkehrende Muster und Erfolgskonzepte. Eines der Ergebnisse: Bei den grössten Verkaufserfolgen ging es thematisch immer um Beziehungen zwischen Menschen.
Was das mit Eigentum zu tun hat? Viel.
Eigentum stellt Beziehungen zwischen Menschen her. Im Eigentum spiegeln sich Abhängigkeit und Freiheit, Entfaltung und Verkümmerung, Macht und Ohnmacht, Last und Lust. Unser Verständnis von Gerechtigkeit richtet sich danach, wer von etwas wie viel bekommt. Wer das nicht glaubt, sollte mal bei einer Testamentsvollstreckung dabei sein.
Derzeit erleben wir einen Paradigmenwechsel im Verhältnis zum Eigentum, an dessen Ende sich noch nicht ermessen lässt, was von diesem Konzept noch übrig bleiben wird. Die Generationen Y und Z (etwa ab 1980 bzw. 2000 geboren) stellen die Beziehung zu Dingen und Menschen auf den Kopf: Alte Statussymbole haben zunehmend ausgedient, Eigentum gilt als Ballast und Exklusivität als überschätzt. Was heute mehr zählt, ist Zugang und Teilhabe. Der Trend geht dank «Sharing Economy» weg vom Eigentum und hin zur blossen Nutzung von etwas. Wozu auf ein Ferienhaus sparen, wenn es Airbnb gibt? Wer braucht in Zeiten von Netflix noch DVDs? Wozu sich ein Auto in die Garage stellen, wenn man gegen Gebühr mal das des Nachbarn nutzen kann, genauso übrigens wie die Bohrmaschine oder den Rasenmäher?
Eigentum stellt Beziehungen zwischen Menschen her.
Das Eigentum misst den Puls des Zeitgeistes und zeigt die Hierarchie von Werten an. Das gilt seit je. In Platons idealem Staat herrschten besitzlose Philosophen, Sokrates war der Meinung, dass geringer Besitz den Menschen den Göttern angleiche, die gar nichts brauchen. Demgegenüber wollte Max Webers protestantischer Geist des Kapitalismus stets neue Bedürfnisse schaffen. Erich Fromm stellte die Frage nach dem Haben oder Sein in den Raum. Doch welches Wertegerüst steckt hinter der Eigentumsskepsis der jungen Generation?
Es sind wohl eher die Umstände, die das Wertegerüst bestimmen, als umgekehrt. Dass statisches Eigentum als Klotz am Bein gilt, hängt auch mit der Multiplikation der Optionen bei gleichzeitig vergrössertem Bewegungsradius zusammen. Noch vor 150 Jahren bewegten sich die Menschen meist nicht mehr als 200 Kilometer von ihrem Wohnort weg. Heute fliegen Schüler nach dem Ende des Gymnasiums erst einmal nach Thailand oder Australien. Junge Menschen von heute wollen sich nur ungern festlegen. Sie wollen weniger kaufen, und öfter nur mal gucken, sie sind Touristen des Alltags.
Teure Nutzung
So unverfänglich und hip die «Sharing Economy» daherkommt (Stichwort: «sharing is caring»), so viele Fragen wirft sie gleichwohl auf. Denn tatsächlich bedeutet die «Sharing Economy» auch oft, dass man für weniger fast genauso viel bezahlen soll. Bei Musik ist das bereits der Fall, ohne dass es als grosser Skandal gilt. Man kann die bei iTunes heruntergeladenen Songs weder verschenken oder vererben, man darf sie allenfalls zeitlich begrenzt auf einer begrenzten Anzahl von Geräten nutzen. Auch E-Books von Amazon sind nur Lizenzen auf digitale Kopien.
Der Paradigmenwechsel des Eigentums führt also weg vom Fetischcharakter der Ware und hin zur entgeltlichen zeitlichen Verwahrung eines Anschauungsobjekts. Wenn für den französischen Ökonomen und Soziologen Prodhoun Eigentum gleich Diebstahl war, was ist dann diese Form von «Sharing Economy», wenn nicht Betrug? Das jedoch stört die junge Generation ebenso wenig, wie die Tatsache, dass sie für die Nutzung von Google, Facebook und Co. mit ihren Daten bezahlt, und zwar so, dass es unmöglich ist, dieses Entgelt je zurückzuverlangen oder auch nur dessen Preis festzusetzen.
Hinter der Idee der «Sharing Economy» steht also nicht zwangsläufig eine nachhaltigere, humanere und ressourcenschonendere Ökonomie. Man kann in ihr auch Anzeichen für eine «Careless Society» sehen, die eine Aversion dagegen hat, sich um etwas zu kümmern. Viele Menschen wollen eben konsumieren und zurückgeben oder wegwerfen, nicht jedoch besitzen, reparieren, erhalten und vererben. Eigentum verpflichtet. Nutzung entbindet von der Pflicht des Kümmerns. Wer einen Garten besitzt und pflegt, weiss, wie viel Arbeit in Schönheit steckt.
So unverfänglich und hip die «Sharing Economy» daherkommt, so viele Fragen wirft sie gleichwohl auf.
Eigentum bedeutet Selbstbestimmung
Eigentum bedeutet schliesslich nicht nur Raffgier und Akkumulation. In der Beziehung zu den Dingen steckt auch eine besondere emotionale Ebene. Die Verhaltenspsychologie kennt den sogenannten «Endowment-Effekt» bei welchem Eigentümer den Wert ihres Häuschens regelmässig als über dem Marktpreis liegend einschätzen, weil sie eine emotionale Beziehung dazu entwickelt haben. Diese emotionale Ebene fehlt der jungen Generation häufig noch. Spätestens jedoch, wenn der Zustrom von Menschen in die Grossstädte weiter anhält, und bald über 100 Bewerber auf eine Mietwohnung kommen, wird auch die junge Generation merken, dass die Idee des Eigentums ein Stück Freiheit und Selbstbestimmung bedeutet und blosse Nutzbarkeit eine Chimäre sein kann.
In dieser Kolumne vertritt der Autor seine eigene Meinung.
Diese deckt sich nicht in jedem Fall mit derjenigen der Redaktion.
Fotos: gateB, unsplash.com