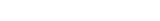Grundbedürfnis Sicherheit
Das Streben nach Sicherheit ist ein Grundantrieb des menschlichen Daseins. Aber zu viel Sicherheit hemmt unsere Kreativität und raubt uns Erlebnisse. Weshalb wir auch den Nervenkitzel brauchen und welche Rolle die Intuition beim Abwägen von Sicherheit und Risiko spielt, erklärt Lutz Jäncke, Professor für Neuropsychologie an der Universität Zürich.
Herr Jäncke, wie schätzen Sie sich ein? Sicherheitsliebend oder risikofreudig?
Das schwankt ein bisschen. Eigentlich bin ich ein sehr sicherheitsorientierter Mensch, aber mein Leben hat sich in die andere Richtung bewegt. Als Professor in Deutschland war ich Beamter. Doch dann habe ich der sicheren Anstellung den Rücken gekehrt und bin in die Schweiz ausgewandert. Mit Familie notabene. Das war heftig. Aber als Wissenschaftler muss man manchmal neue Wege gehen.
Das Bedürfnis nach Sicherheit ist sehr individuell. Welche Faktoren spielen eine Rolle?
Sicherheit hat sich im Rahmen der Evolution des Menschen als sehr wichtig erwiesen. Sie ist ein Grundantrieb des Menschen, der es uns ermöglicht, unser Leben zu erhalten und das unserer Angehörigen zu sichern. Auch wenn wir es nur ungern zugeben: Die Sicherung unseres Einkommens bestimmt unser Leben. Es ist einer von mehreren starken Antrieben, die in uns unbewusst verankert sind. Aber es gibt noch weitere: Als biologische Wesen haben wir sehr viel gemein mit unseren nächsten Verwandten, den Affen. Wie sie lieben wir Sex, verteidigen unser Revier, mental, aber auch physisch, notfalls bis aufs Blut. Wir wissen Zuneigung zu schätzen und Kooperation. Und wir investieren unfassbar viel in die Aufrechterhaltung von Bindung und Zuneigung – wie kaum ein anderes Tier auf der Welt. Ich würde fast behaupten, dass der grösste Anteil der mentalen Ressourcen in den Aufbau und den Erhalt von Beziehungen fliesst.
Steckt nicht auch ein Sicherheitsbedürfnis dahinter?
Auf jeden Fall, denn der grösste Feind des Menschen ist der Mensch. Wir müssen sehr viel investieren, um herauszufinden, welchen Menschen wir vertrauen können. Aufbau von Vertrauen ist ein schwieriger, aber auch wichtiger Prozess. Vertrauen können bedeutet Sicherheit gewinnen.
Was machen Krisenzeiten mit unserem Sicherheitsempfinden?
Das ist sehr spannend. Corona hat uns vor Augen geführt, wie panisch Menschen in Situationen reagieren, die sie nicht überschauen können – und das auf unterschiedlichen Niveaus. Wenn wir etwas nicht verstehen, versuchen wir, das, was Unsicherheit auslöst, zu erklären. Wir suchen nach Informationen und Interpretationen und werden anfällig für alles Mögliche. In der ersten Phase der Corona-Krise haben wir relativ schnell Übereinstimmung in allen europäischen Völkern darüber gehabt, wie man sich zu verhalten hat. Aber mittlerweile kippt das. Viele finden die ersten Massnahmen nicht mehr so gut, weil sie beginnen, die Fakten und die vielfältigen Konsequenzen zu verstehen.
Fakten, die die finanzielle Sicherheit betreffen?
Ja, und die für unser Leben von herausragender Bedeutung sind. Wir hängen von Ressourcen ab. Wir brauchen Geld, um zu leben. Geld ist aber auch wichtig, um unsere Rangordnung in den sozialen Gemeinschaften zu sichern. Die Position und die Anerkennung in der Gesellschaft sind für uns zentral. Und plötzlich wird es immer schwieriger, die Position zu halten, und man sorgt sich, sein Leben finanzieren zu können. Die Wirtschaft bröckelt vor sich hin und man fragt sich, ob man sich sein gewohntes Leben nächstes Jahr noch leisten kann.
«Sicherheit ist gut. Aber sie führt dazu, dass wir viele interessante Dinge nicht erleben.»
Dann plagen aktuell viele Menschen schlimme Sorgen?
Die schlimmsten Sorgen, die ein Mensch haben kann, sind tatsächlich soziale Sorgen. Die amerikanischen Psychologen Holmes und Rahe haben 1967 eine Skala zum Bestimmen des persönlichen Stresspegels entwickelt. Sie ist unter dem Titel «Holmes-Rahe Life Stress Inventory» bekannt geworden. Das Stressigste, was dem Menschen widerfahren kann, sind gemäss dieser Skala der Verlust einer Rangordnungsposition, der Verlust eines Menschen oder eine Scheidung.
Dann ist ein grosses Sicherheitsbedürfnis umso verständlicher. Was sind denn die negativen Seiten?
Sicherheit ist gut. Aber sie führt dazu, dass wir viele interessante Dinge nicht erleben. Die Kreativität leidet darunter. Wer sicher sein will, muss sein Verhalten kontrollieren. Der kreative Mensch ist freier, zwangloser. Auch die Hirnaktivitäten sind anders. Im Moment der Kreativität findet man deutlich weniger Aktivitäten in jenen Hirnregionen, die mit Kontrollprozessen betraut sind. Ein sicherheitssuchender Mensch ist im schlimmsten Fall paranoid, sieht überall Gefahren und muss sich kontrollieren, um ja nicht in eine vermeintlich gefährliche Situation zu geraten. Das hemmt natürlich den Erkenntnisweg.
Ein bisschen Risiko tut also gut?
Eine Situation, die ein bisschen von der Sicherheit abweicht, erregt uns. Ein bisschen Risiko, das nicht allzu weit vom mittleren Sicherheitsbedürfnis entfernt ist, finden wir toll. Das Sicherheitsbedürfnis ist allerdings individuell und eine Persönlichkeitseigenschaft.
Verschiebt sich die im Laufe eines Lebens?
Ja, die hängt von diversen Rahmenbedingungen ab. Wer total gelangweilt ist, der braucht Nervenkitzel. Ich bin der Überzeugung, dass Bungee-Jumping ein Ausdruck von mangelnder Anforderung ist. Kein Syrer käme auf die Idee, an einem Seil befestigt von einer Brücke zu springen. Es gibt eine spannende Beobachtung über Affen in einer Provinz in Indien: Die Affen werden von der Bevölkerung ernährt und müssen für ihre Nahrung nicht mehr selbst sorgen. Die sind so gelangweilt, dass sie sich Aufgaben suchen, die ihnen Thrill bereiten. Aufnahmen zeigen, wie sie auf 20 Meter hohe Türme klettern und in 2 Meter breite Wasserbecken reinspringen. Ein lebensgefährliches Unterfangen. Wer keine Aufgaben hat, sucht sich Risiko. Etwas, das die Sicherheit auflöst. Das treibt uns an, das bewegt uns. Wenn wir zu sicher sind, werden wir schläfrig.
Schätzen wir Risiken falsch ein?
Wir haben die bemerkenswerte Fähigkeit, in einer selbst aufgesuchten Risikosituation die Risikoeinschätzung zu hemmen. Wir haben das anhand eines Fahrsimulators untersucht. Während die Leute fuhren, haben wir die Hirnaktivitäten gemessen. Die Personen sollten Strecken in immer kürzerer Zeit abfahren. Mit der Zeit haben sie sich so animiert gefühlt, dass sie durch die Städte gerast sind wie die Wahnsinngen. Das Bemerkenswerte: In den Situationen, in denen sie beim Autofahren mehr Risiko eingegangen sind, haben sie alle Hirngebiete abgeschaltet, die für Inhibition, also Hemmung, zuständig sind. Damit haben sie die Risikoeinschätzung gewissermassen ausgeschaltet.
Aber Sicherheit hängt schon auch mit Vernunft zusammen?
Ich bin kein grosser Freund davon, dem Menschen zu viel Vernunft zuzuschreiben. Wir sind mitunter das unvernünftigste Wesen auf der Welt. Sicherheit ist für uns ein grundsätzlicher Verhaltensantrieb. Bei all dem, was wir an Verhaltenskontrolle entfalten, bleiben über 90 Prozent der Hirnaktivität unbewusst. Auch dann, wenn wir uns in Sicherheit wiegen. Wir denken immer, wir würden rational zu der Entscheidung gelangen, aber der grösste Teil unserer Entscheidungsprozesse wird durch neurophysiologische Aktivitäten gesteuert, derer wir uns nicht bewusst sind. Auch, wenn es um Entscheide geht, die unsere Sicherheit betreffen.
«Wir müssen sehr viel investieren, um herauszufinden, welchen Menschen wir vertrauen können.»
Welche Rolle spielt die Intuition respektive das allseits bekannte Bauchgefühl bei der Risikoeinschätzung?
Die Intuition ist wichtig, und sehr oft drängt sie sich uns auf. Die Frage ist, ob wir ihr auch nachgeben. Dieses intuitive Gefühl ist ein halbbewusstes Phänomen, das wir nicht verbal beschreiben können. In gefährlichen Situationen, in denen wir nicht genügend Zeit haben zu überlegen, kommt das Bauchgefühl zu Wort. Meistens täuscht es uns nicht.
Der Traum vom Eigenheim ist ungebrochen. Bauen stellt für die Bauherrschaft jedoch ein nicht unerhebliches Risiko dar. Wie wichtig sind Absicherungen für die subjektive Sicherheit?
Bauen ist immer belastend, weil vieles in diesem Kontext unvorhersehbar ist. Auch wenn wir die Zukunft nicht vorhersagen können, wir versuchen es trotzdem. Je unsicherer die Vorhersagen werden, desto unwohler fühlen wir uns. Von daher empfehle ich Absicherungen, die helfen, den Stress zu lindern.
Haben Sie einen Rat, wie sich eine gute Balance zwischen Sicherheit und Risiko schaffen lässt?
Darüber mache ich mir keine Gedanken. Ich habe eine andere Maxime: Ich versuche, mein Leben so zu gestalten, dass ich zufrieden bin.