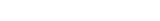«Die Zuger wünschen sich eine lebendigere Stadt»
Mitwirkung statt Verordnung von oben: Immer mehr Städte möchten ihre Bevölkerung bei Fragen zur Nutzung des öffentlichen Raums mitdiskutieren lassen. Regula Kaiser, Leiterin Stadtentwicklung, über ein Mitwirkungsprojekt in Zug und was sie dabei lernte.
Unter dem Titel «freiraum-zug» startete die Stadt Zug 2012 ein Mitwirkungsverfahren. Wie viele Veranstaltungen sollen in der Stadt stattfinden? Wann ist Ruhe? Welche Zonen sollen mehr genutzt werden? Diese und weitere Fragen wurden zusammen mit der Bevölkerung diskutiert. Am Ende des Prozesses standen eine Charta und ein Nutzungskonzept für den öffentlichen Stadtraum.
Frau Kaiser, was war die Motivation für das Projekt «freiraum-zug»?
Wir hatten festgestellt, dass durch die rasante Verdichtung der Nutzungsdruck steigt, gerade an den prominenten Lagen in den Zuger Parkanlagen – besonders am Seeufer. Dadurch wurden schwächere Gruppen verdrängt, konkret: Jugendliche, die viel Raum eingenommen hatten. Nun wollten wir einen Dialog mit den verschiedenen Nutzergruppen führen und alle an einen Tisch bringen. Gerade den Jugendlichen war gar nicht bewusst, dass sie die Möglichkeit haben, sich zu wehren, wenn sie verdrängt werden. Ein weiteres Ziel war, darauf hinzuweisen, dass es ein grosses und vielfältiges Raumangebot in der Stadt Zug gibt, dessen Potenzial teilweise noch nicht ausgeschöpft ist, etwa der Postplatz, der Bundesplatz, der Hirschenplatz, der Arenaplatz, und die Metalli.
Wie haben Sie dieses Verfahren gestaltet?
Wir haben den Prozess zusammen mit der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit quasi aus dem Nichts entwickelt, es gab keine Vorbilder. Konkret haben wir drei grosse Workshops mit je 120 bis 140 Personen sowie Nebenveranstaltungen durchgeführt. Dabei ging es darum, zu eruieren, welche Nutzungen die Bevölkerung an welchen Orten in der Stadt Zug wünscht und wie diese Ansprüche nutzergerecht und ortsgerecht verteilt werden können. Gearbeitet haben wir dabei etwa mithilfe von Stadtplänen, auf denen die Teilnehmenden ihre Interessen visualisieren konnten.
«Es ging darum, zu eruieren, welche Nutzungen die Bevölkerung an welchen Orten in der Stadt Zug wünscht und wie diese Ansprüche nutzergerecht und ortsgerecht verteilt werden können.»
Wie haben Sie denn die Bevölkerung an diese Workshops eingeladen? Und haben Sie alle Gruppen erreicht?
Werbung gemacht haben wir via Medien, Vereine und Mundpropaganda. Um ein breites Publikum zu erreichen, haben wir zudem auf der Strasse Flyer verteilt. Erreicht haben wir vor allem die Personen im mittleren Alter, die organisierten Interessengruppen und die Mitglieder von Vereinen. Unterrepräsentiert waren die Jugendlichen. Daher gab es Nebenveranstaltungen wie etwa Video-Workshops, ein Dialog-Café oder einen Malworkshop für Kinder.
Und was ist dabei herausgekommen?
Das Fazit aus den Workshops war für mich: Die Zugerinnen und Zuger wünschen sich eine lebendigere Stadt. Abgesehen von den Sommermonaten ist es sehr ruhig im öffentlichen Raum. Gerade am See ist etwas mehr Leben möglich, sei es in Form von Kleinkunst oder Gastro-Angeboten. Aber auch in den Quartieren wünschen sich die Menschen, dass mehr läuft. Allerdings – und das ist eine weitere Erkenntnis – kann man als Stadtverwaltung nicht alles steuern. Besser soll man etwas mehr zulassen und etwas weniger planen. Das Thema Freiraum dürfte bei zunehmender Verdichtung wichtiger werden, aber es kommen neue Themen dazu wie zum Beispiel Urban Gardening, Strukturwandel im Detailhandel, Sharing-Angebote oder mobile Möblierungen.
Formal haben wir eine Charta erarbeitet mit Thesen dazu, wie das Leben im öffentlichen Raum verhandelt werden soll. Die Nutzungswünsche der Bevölkerung haben wir, gegliedert nach Gebieten, auf Karten festgehalten. Der Stadtrat hat einen Katalog von Massnahmen beschlossen, um die wichtigsten Ziele zu erreichen und Weichen für die Veränderung zu stellen.
«Ein Mitwirkungsverfahren führt zu einer besseren Dialogkultur und oft auch zu einer grösseren Lösungsvielfalt.»
Können Sie anderen Städte solch ein Mitwirkungsverfahren, empfehlen? Wenn ja, worauf ist dabei besonders zu achten?
So ein Prozess ist aufwendig und teuer, aber er lohnt sich! Denn man erfährt direkt, welche Themen die Bevölkerung beschäftigen. Ein Mitwirkungsverfahren führt zu einer besseren Dialogkultur und oft auch zu einer grösseren Lösungsvielfalt. Für unsere Stadt war «freiraum-zug» in diesem Moment genau das Richtige und hat bei uns auch viele Diskussionen in Gang gesetzt und Projekte ermöglicht. Solche Prozesse können jedoch kaum kopiert werden. Sie entstehen aus der aktuellen politischen Diskussion und dem Handlungsbedarf einer Stadt heraus. Wichtig ist, dass der Mitwirkungsbereich genau beschrieben und eingegrenzt wird. Mitwirkung ist kein Schattenparlament. Die Kompetenzen für die Umsetzung liegen in der Regel beim Parlament, und dieses kann unter Umständen auch anders entscheiden, als sich dies die Teilnehmenden gewünscht haben. Mitwirkung ist nie repräsentativ. Den Teilnehmenden muss immer rapportiert werden, was erreicht werden konnte – und was nicht. Letztlich führt ein Partizipationsprozess aber dazu, dass die Menschen sich ernster genommen fühlen, als wenn sie «nur» informiert werden.